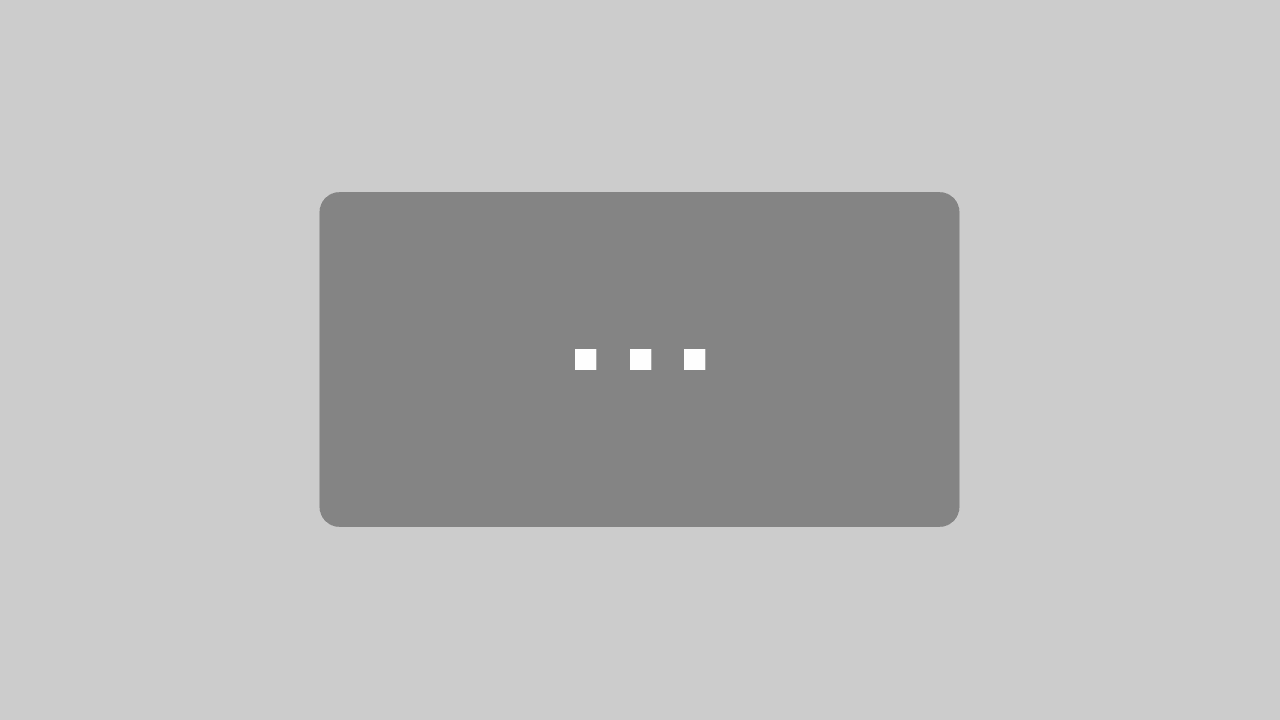Schwerttanz
Dieses Jahr
13.07.2025 (2.Sonntag im Juli)Nächstes Jahr
12.07.2026 (2.Sonntag im Juli)Turnus
jährlich
Festausübung
aktuell
Geografie
Ort
Kreis
Region
Staat
Beschreibung
Ablauf:
Der Schwerttanz (dialektal: Schwertletanz), ursprünglich ein Fastnachtsbrauch, wird heute alljährlich am zweiten Sonntag im Juli, im Anschluss an die zweite Schwedenprozession aufgeführt. Seine Träger sind die Rebleute, die sich nach ihrem Zunfthaus "beim Wolfen" auch Wolferzunft nennen.
Der Ablauf ist streng ritualisiert: Am Aufführungstag treffen sich die Mitglieder der Fahnenkompagnie der Schwerttänzer frühmorgens zu einem Imbiss in der Zunftstube im Aufkircher Tor. Dazu stellt sich auch der "Hänsele" ein, ein Narr im typischen Überlinger Fastnachtsgewand, dem schwarzen Flickenkleid mit paillettenbesetzer Stoffmaske, Fuchsschwanz im Nacken, kleinen Schellen und mit einer kurzstieligen Peitsche, der sogenannten Karbatsche in der Hand. Dieser Figur fällt während des Brauches eine wichtige Außenseiterrolle zu: Vor dem allgemeinen Aufbruch besprengt der Erste Platzmeister der Kompagnie den Hänsele mit Weihwasser und stößt ihn danach mit einem kräftigen Fußtritt und den Worten "Hänsele, gang in Gott's Name" auf die Straße hinaus. Von nun an zieht der Hänsele, der übrigens den ganzen Tag über kein Wort sprechen darf, wie eine Art Stiefkind der Schwerttänzer durch den Stadtteil "Dorf", in dem die rundbogigen Kellereingänge der Häuser daran erinnern, dass hier einst die Rebleute lebten. Noch im "Dorf" vereinigt sich die Fahnenkompagnie, bestehend aus den beiden Platzmeistern, dem Fähnrich, dem Säckelmeister und den Spielleuten, mit der übrigen Kompagnie, um zunächst in voller Uniform gemeinsam in die Kirche zu ziehen und einer Heiligen Messe beizuwohnen. Früher wurde diese Messe im Jodokskirchlein im "Dorf" gelesen, heute findet sie im Nikolausmünster statt, der Hauptkirche Überlingens. Der einzige, der den Sakralraum nicht betreten darf, ist der Narr. Er treibt sich unterdessen in den Wirtshäusern herum und bettelt mit einer Sammelbüchse schweigend um Geld. Wenn allerdings der Gottesdienst seinem liturgischen Höhepunkt, der Wandlung von Brot und Wein, entgegengeht, taucht der Hänsele wieder in unmittelbarer Nähe der Kirche auf, um genau in dem Augenblick, in dem drinnen der Priester am Altar die Hostie und den Kelch emporhebt, draußen mit seiner Karbatsche, zu "schnellen", also zu knallen, und damit den Gottesdienst an seiner feierlichsten Stelle zu stören. Bei der eigentlichen Aufführung des Schwerttanzes dann, in der Regel auf der Hofstatt unterhalb des Rathauses, bittet der Erste Platzmeister zunächst den Oberbürgermeister um die Genehmigung des Tanzes. Ist diese erteilt, beginnen die Tänzer zu den Klängen der pfeifenden und trommelnden Spielleute ihre genau festgelegten Tanzfiguren auszuführen: etwa die Achtertour, bei der sich die Ausführenden jeweils an der Degenspitze des Vordermanns festhalten, den Degensprung, bei dem der Degen des jeweils anderen übersprungen wird (vgl. die Redensart: "Jemanden über die Klinge springen lassen"), und schließlich den "Maschen", einen dichten Kreis aller Mitwirkenden, dessen Dach eine aus den übereinander gelegten Degen geformte Rosette bildet. Hat sich der "Maschen" geschlossen, springt der Hänsele hinein und wartet in geduckter Stellung ab, bis sich das ganze Gebilde über ihm und um ihn einmal um die eigene Achse gedreht hat. Parallel dazu schwenkt der Fähnrich die Fahne über dem "Maschen", und der Erste Platzmeister bringt mit geschwenktem Hut ein "Hoch auf die Vaterstadt Überlingen und den Herrn Oberbürgermeister" aus. Anschließend löst sich der "Maschen" wieder auf. Nach den letzten von den Schwerttänzern allein ausgeführten choreographischen Figuren findet das Tanzritual seinen Abschluss mit den sogenannten "Maidlintänzen" bei denen jeder Schwerttänzer sich eine Tanzpartnern aus dem Publikum sucht, in der Regel eine der Überlinger Trachtenträgerinnen mit Radhaube, um mit ihr einen Paartanz zu vollführen. Je nach Witterung wird das gesamte Schauspiel noch an anderen Stellen der Stadt wiederholt.
Geschichte:
Die erste urkundliche Erwähnung des Brauches findet sich in einem Ratsprotokoll vom 8. Februar 1646, in dem die obrigkeitliche Tanzerlaubnis mit gewissen Einschränkungen formuliert ist: "Den ledigen burschen ist auf mehrmaliges anhalten der Schwerttanz in der Zunft von 12 bis 5 Uhr, jedoch ohne Spieleut und den medlintanz vergont." Aus der Selbstverständlichkeit, mit der hier von den einzelnen Elementen des Tanzes gesprochen wird, lässt sich schließen, dass der Tanz zu dieser Zeit in Überlingen bereits eine längere Tradition hatte.
Während in der frühesten Nachricht als Ausführende noch ganz allgemein die ledigen jungen Männer genannt werden, scheint nach dem Ende Dreißigjährigen Krieg die Wolferzunft bzw. die Zunft der Rebleute den Schwerttanz an sich gezogen zu haben. Am 3. Februar 1670 heißt es jedenfalls im Ratsprotokoll: "Den ledigen Rebknechten ist die Fastnachtsrecreation auf nächstkommenden Sonn- und darauffolgenden Donnerstag wie auch die drei Fastnachttage, doch mit selbst anerbottener Bescheidenheit, ohne Schwerttanz, bis 9 Uhr nachts und länger nicht vergont worden." Vom Jahr 1789 an liegt schließlich die handgeschriebene Chronik der Schwerttänzer vor, in der die Geschichte des Brauches für die Folgezeit nahezu lückenlos dokumentiert. Als Überlingen 1803 seinen Status als Reichsstadt verlor und Baden angegliedert wurde, gab es zunächst eine längere Unterbrechung der Tanztradition, bis sich der Schwerttanz dann im Geiste der Romantik allmählich verselbständigte und außerhalb der Fastnacht ein Eigenleben zu entwickeln begann. Am 26. Mai 1821 etwa wurde er anlässlich eines Besuches des Großherzogs Ludwig von Baden in Überlingen erstmals in außerfastnächtlichem Zusammenhang aufgeführt. In den Jahrzehnten darauf setzte sich der Loslösungsprozess von der Fastnacht fort, und nach 1870 trat die Schwerttanzkompagnie an Fastnacht überhaupt nicht mehr in Erscheinung. Fortan wurde nur noch in oft mehrjährigen Abständen bei besonderen städtischen Ereignissen getanzt, bis die Kompagniemitglieder 1966 den Beschluss fassten, ihren Schaubrauch künftig wieder alljährlich aufzuführen, allerdings nicht mehr in der Fastnachtszeit, sondern jeweils im Anschluss an die zweite Schwedenprozession im Juli.
Zu erwähnen ist noch die Ursprungslegende des Brauches, mit der in Überlingen das Schwerttanzprivileg und insbesondere auch die Rolle des stummen, den Gottesdienst störenden Narren erklärt wird. Danach musste die Reichsstadt dem Kaiser zu einem nicht näher genannten Zeitpunkt hundert Mann für einen Kriegszug stellen. Vor dem Ausmarsch hätten alle die Heilige Messe besucht; nur einer, ein "Lebemensch", sei statt dessen in den Wirtshäusern herumgezogen. Genau dieser eine habe dann später in der Schlacht sein Leben verloren, während alle anderen wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt seien. An ihn, den zur Strafe für seine Ignoranz gegenüber Gott Gefallenen, erinnert nach der lokalen Überlieferung der stumme Narr beim Schwerttanz. - Diese Deutung der Narrenrolle ist insofern bemerkenswert, als die frühesten Narrendarstellungen in der bildenden Kunst im ausgehenden Mittelalter, den Narren meist in Psalterhandschriften im Initial des Psalms 52 zeigen, der mit den Worten beginnt: "Dixit insipiens in corde sueo: Non est Deus - Der Narr sprach in seinem Herzen: Es gibt keinen Gott." Im Rollenverhalten des Überlinger "Hänsele", der vor dem Schwerttanz den Gottesdienst durch das Schnellen mit der Karbatsche stört, ist mittelalterliche Deutung der Narrenfigur als Ignorant Gottes noch nach mehr als einem halben Jahrtausend ungebrochen erhalten.
Siehe auch: Schwedenprozession in Überlingen